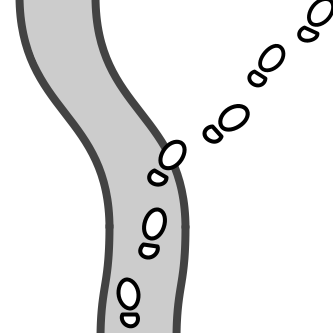Die Site wird gerade aufgebaut. Farben im Menü: fertig halbfertig unfertig (Stand: 18.11.2025)
Die Aufklärungszeit: Der unsichtbare Schutzmantel der Feminina
Der Beginn der Aufklärungszeit wird oft um 1688 (Bill of Rights in England) oder 1715 (nach dem Tod des Sonnenkönigs in Frankreich) datiert. Sie markiert den Anfang moderner Demokratien und der Bewegung hin zur Gleichberechtigung.
Doch der Weg war steinig. Das Leid und die Verzweiflung derer, die sich der jahrtausendealten Ungerechtigkeit entgegenstellten, sind heute kaum zu ermessen. Selbst Jahrzehnte nach dem Beginn der Aufklärung wurden in Europa noch Frauen als Hexen verbrannt (z.B. 1756 in Bayern, 1782 in der Schweiz). Auch die Hinrichtung der französischen Frauenrechtlerin Olympe de Gouges 1793 in Paris zeigt, dass die Unterdrückung der Emanzipation selbst während der Französischen Revolution fortgesetzt wurde.
Der Kampf um Gleichberechtigung begann also lange vor unserer Zeit und war in der Aufklärung besonders heftig. Trotz ihres hehren Namens war diese Epoche alles andere als friedlich und harmlos.
Sprache gottgegeben und unangreifbar
Was das alles mit unserer Sprache zu tun hat? Vielleicht mehr, als wir heute vermuten.
Die meisten Aufklärer zweifelten nicht am schöpferischen Wirken Gottes. Die Welt und alles in ihr, inklusive der Sprache, galt als göttliches Werk. So war es undenkbar, weiblichen Moveme wie „-in“ und „-innen“ oder Doppelnennungen infrage zu stellen – selbst wenn sie Frauen benachteiligten. Genauso wenig dachte man damals darüber nach, ob diese Endungen vielleicht von Männern eingeführt wurden, um Frauen als Objekt der Begierde sichtbar zu machen. Während also die soziale Ungerechtigkeit angegangen wurde, blieb die Sprache noch lange unberührt.
Die „Aufladung“ der Feminina: Erkennungszeichen des Kampfes
Trotzdem erreichte der Kampf für eine gerechtere Welt, auch der für Frauenrechte, die Sprache – auf eine ganz besondere Art. Und genau das könnte etwas Grundlegendes ausgelöst haben, das sich bis heute auswirkt und vielleicht sogar am aktuellen Sprachenstreit beteiligt ist.
Betrachten wir ein Beispiel aus der heutigen Zeit: Jeder kennt den Vorwurf gegen diejenigen, die die heutige Gendersprache mit dem Glottisschlag (z.B. Bürger*innen) nutzen. Die Autorin Judith Basad fasste es prägnant in der NZZ zusammen: „Beim Gendern geht es vor allem darum, sich selbst als den besseren Menschen zu inszenieren.“ Es geht also „nicht nur“ um die Sichtbarmachung nonbinärer Menschen, sondern auch um eine zusätzliche Botschaft zwischen den Zeilen: „Wir sind die Guten, die Gerechten. Ihr seid noch nicht so weit, ihr habt das noch nicht verstanden. Wir kämpfen für eine bessere Welt, ihr nicht.“
Sprechpause und Gendergap wurden zu einem Erkennungszeichen und durch eine moralische Aussage aufgeladen.
Die These: Wie die Feminina zu Symbolen des Widerstands wurden
Könnte es nicht sein, dass sich im elementareren und existentielleren Kampf während der Aufklärungszeit das einzige damals vorhandene Zeichen für die Gleichberechtigung – eben die „Feminina“ mit dem „-innen“ und den Doppelnennungen – ähnlich auflud wie heute Genderstern und Sprechpause?
Damals war es ein mutiges Statement, wenn jemand „Freunde und Freundinnen“ oder „Mitbürger und Mitbürgerinnen“ sagte. Es war mehr als nur eine Nennung der Frauen. Es war ein klares Bekenntnis: „Ja, ich trete ein für die Teilnahme der Frauen an dem, was bisher nur Männern vorbehalten war. Ich gehöre zu dieser Gruppe, und es ist mir egal, ob die Feinde der Gleichberechtigung mich schneiden, ich meine Arbeit verliere oder angeklagt werde. Ihr Freunde der Gleichberechtigung, ihr könnt auf mich zählen; ich sitze mit euch in einem Boot.“
Der Kampf für die Gleichberechtigung der Frau war damals härter und gefährlicher. Wer für die Beteiligung von Frauen an Lesekreisen, schriftstellerischer Arbeit oder den Künsten eintrat, brauchte Mut – viel mehr Mut als heute.
So konnten sich die Feminina in dieser Zeit, als Sprache noch als gottgegeben und unveränderlich galt, trotz ihrer klaren Benachteiligung der Frau mit dieser revolutionären Botschaft aufladen. Wir können davon ausgehen, dass der Grad der Aufladung sich an der Heftigkeit des Kampfes orientiert. Angesichts der brutalen und festgefahrenen Ungerechtigkeit muss diese Aufladung also immens gewesen sein – viel stärker als die heutige beim Genderstern.
Der Fachbegriff für Aufladungen von Begriffen in eine als positiv empfundene Richtung wird in der Sprachwissenschaft Meliorisierung genannt. Meistens geht es dabei „nur“ um eine Veränderung der Wahrnehmung, weg vom neutralen hin zum positiveren.
Hier kommt statt einer einfachen Verbesserung noch etwas Zusätzliches hinzu; es passiert eben eine Aufladung. Die Endung „-in/-innen“ wird mit einer zusätzlichen, einer emotionalen, psycho-sozialen Zusatzbotschaft bereichert, eben aufgeladen: Ich nutze das Kennzeichen einer wertvollen, edlen Bewegung. Eine Bewegung, die die Welt gerechter machen will.
Beispiele für sprachliche Aufladung
Zur Veranschaulichung solcher tiefer gehenden Meliorisierungen, eben der emotionalen Aufladung von Wörtern können wir zwei weitere Beispiele heranziehen:
- „Black is beautiful“: Im US-Bürgerkrieg und danach war das Wort „Black“ mit der Menschenverachtung der Sklaverei verbunden. Martin Luther King und seine Mitstreiter griffen dies aktiv auf, indem sie mit „Black is beautiful“ eine offensive Umdeutung der negativen Konnotation vornahmen. Es war ein aktives Verändern des „Tons zwischen den Zeilen“.
- Schalke vs. BVB: Die Farben Blau/Weiß und Gelb/Schwarz lösen bei den jeweiligen Fans völlig unterschiedliche Emotionen aus. „Schalke“ ist für Fans viel mehr als die ursprüngliche Bedeutung einer Siedlung; es ist emotionale Verbundenheit und das Gefühl, zu einer Gruppe zu gehören – den „Guten“. Dieselben Farben oder Wörter können bei anderen, den BVB-Fans, das krasse Gegenteil auslösen (Pejorisierung= Aufladung Richtung ’negativ‘).
Wie schon gesagt: Eine ähnliche Situation erleben wir heute beim Genderstern und der Sprechpause, die von den einen meliorisiert und von den anderen pejorisiert sind.
Könnte der analoge Vorgang zur Aufklärungszeit, der angesichts der härteren Umstände deutlich stärker gewesen sein müsste als heute, ein Schlüssel zur Auflösung unseres Gendersprachenstreits sein?
Die Wörter, die den Kampf für die Emanzipation am deutlichsten ausdrückten, waren Formen wie „Bürgerinnen“ oder neue Sammelbegriffe wie „Bürger und Bürgerinnen“. Ihre Verwendung war, im Kontext der Zeit, mindestens so provokant wie der heutige Genderstern. Weniger wegen der Sprachform selbst, die bekannt war, sondern wegen ihres revolutionären Charakters.
Den Geist dieser Zeit hat Angela Steidele in ihrem Roman „Aufklärung“ auf sehr schöne Art greifbar gemacht. Sie beleuchtet in der Sprache von damals die Welt um Musiker Bach und Sprachwissenschaftler Gottsched und vor allem die Welt der Frauen zu dieser Zeit. Mutiger Frauen wie die „Bachin“, die „Gottschedin“ und die „Neuberin“, die es wagten, Frauenrechte einzufordern. Sehr schön wird hier deutlich, wie das weibliche Movem mehr war als nur ein Morphem für „Frau“. Es war ein mutiges Statement für Gleichberechtigung in einer gerechteren Welt!
Fazit und Ausblick
Macht diese separate Nennung („Meine verehrten Zuhörer und Zuhörerinnen“) heute, 200 Jahre nach der ersten Integration der Frauen, 100 Jahre nach ihrem Wahlrecht und 50 Jahre nach dem Fall der letzten Restriktionen, immer noch Sinn? Wo sich sogar Parteien, die Frauen am Herd sehen wollen, ihrer bedienen? Hat sie heute noch die Botschaft, die sie früher trug, oder verwässert sie sie eher?
Sollten wir nicht besser der Sprechbarkeit und den Nonbinären zuliebe wieder zu den Jahrtausende alten Begriffen zurückkehren? Einfach „Guten Abend, liebe Zuhörer“ – und alle, die zuhören, sind Zuhörer?
Wenn diese neue These, die der Meliorisierung der Feminina in der Aufklärungszeit, tatsächlich passierte, erklärt sie vieles auf einen Schlag.
Sie erklärt, wieso Goethe und Ebert die Doppelnennungen zu nutzen begannen; eben als Tribut an die Emanzipation der Frauen.
Sie erklärt aber auch, wieso Hitler und Goebbels sie nutzten. Goebbels in seiner „schwierigsten“ Rede, in welcher er dem Volk die Zustimmung zum ‚Totalen Krieg‘ abgewann, gleich 8 Mal; 5 Mal davon sogar im Fließtext. Der einfache Grund: Die Doppelnennungen waren selbst hundert Jahre nach ihrer Einführung immer noch von einem solch strahlenden Glanz erfüllt, dass er seine brutalen Absichten hinter diesem Strahlen verstecken konnte.
Sie erklärt auch, wieso niemand sich nach 1945 an die Doppelnennungen Goebbels erinnern konnte, obwohl er sie nicht gerade leise und unbemerkt ins Mikrofon brüllte. Wahrscheinlich ergänzten sich hier die Verdrängung nach ’45 und die Unantastbarkeit der meliorisierten Doppelnennungen.
Das ist ebenfalls mit Abstand die plausibelste Erklärung, wieso die feministische Linguistik in den 1980ern nicht merkte, in welch furchtbare Fußstapfen sie da trat, als sie behauptete, sie müssten „endlich die Feminina in die Sprache bringen“, weil das „die Patriarchen bisher erfolgreich unterdrückt“ hätten. Nach der Meliorisierungsthese verbarg auch hier der strahlende Glanz der meliorisierten Feminina den Blick darauf, dass die schlimmsten Patriarchen die Feminina gleich milliardenfach per Volksempfänger in die Ohren eines gleichgeschalteten Volkes pressten. Es also nicht die Frauen waren, die die Feminina in die Sprache brachten, sondern in viel mächtigerer Verbreitung die Nazis.
Zusammengefasst: Die weiblichen Moveme, die „-in‘s und -innen‘s, erhielten im deutschen Sprachraum einen wirklich besonderen Unangreifbarkeitsmantel, den unsere Geschwistersprachen bei ihren Femininmovemen nicht hatten.
Die älteste und stärkste Faser bekamen auch sie durch die Meliorisierung während der Aufklärungszeit.
Die beiden anderen Fasern sind „rein deutsch“:
- Erst das milliardenfache Einimpfen der Doppelnennungen durch die furchtbar effektive Indoktrination der Goebbel’schen Propaganda tief ins Sprachbewusstsein des Volkes.
- 40 Jahre später das unbewußt, aber erfolgreich darauf aufbauende Wirken der feministischen Linguistik. Sie setzte schließlich sogar die Feminina vor Gericht durch; Hand in Hand mit der Legislative und über massive Vorwürfe, die sich gerade als falsch erweisen.