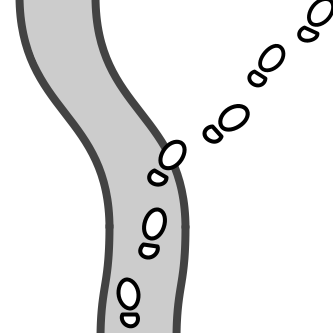Wie es aussieht1, können in gleichberechtigten Gesellschaften nicht gleichzeitig Nomina Agentis in ihrer ursprünglichen Form als Oberbegriffe (teacher, lærar, Lehrer) und auf asymmetrische Art daraus abgeleitete Endungen für Frauen (teacheress, lærarinna, Lehrerin) überleben.
Während unsere Geschwistersprachen ihre Feminina abschafften, stellten wir sie ins Rampenlicht und eliminieren statt dessen die Oberbegriffe.
Dass eher der Weg unserer Geschwistersprachen der bessere zu sein scheint, darauf deuten ihre deutlich besseren Positionen in Gender-Equality-Rankings hin. Verbindende Oberbegriffe für alle Menschen zu haben, scheint der Gleichheit und Gerechtigkeit besser zu bekommen als ständig Geschlechter zu nennen, Frauen sprachlich Männern unterzuordnen und gleichzeitig eine Minderheit zu diskriminieren, die 2017 vom BVG ausdrücklich vor Diskriminierung geschützt wurde.
Wie kam die deutsche Sprache auf diesen eigenartigen Weg?
War es, wie aktuell die meisten vermuten, die Feministische Linguistik, wie die meisten vermuten?
Oder, wie die AFD ständig behauptet, die Grünen und der Wokeismus?
Welchen Anteil hatte die massenhaft per Volksempfänger verbreiteten Doppelnennungen der Nazis?
Gab es vielleicht sogar weiter zurückliegende Besonderheiten auf deutschsprachigem Boden, die unseren Sonderweg erklären?
Wir bewegen uns bei der Ursachensuche Schritt für Schritt in die Vergangenheit, und beginnen bei der Feministischen Linguistik, die sich inzwischen zur Genderlinguistik weiter entwickelt hat.
Um ihren Anteil an der Sexualisierung der Sprache zu ermessen, genügt schon ein kleiner Blick in ihre Entstehungszeit.
Es gibt niemanden, der die Entwicklung der Gendersprache so lange und maßgeblich prägte wie Luise Pusch. Dass sich ihre Ideen maßgeblich in der Sprache niederschlugen, belegt das ihr 2025 verliehene Bundesverdienstkreuz.
41 Jahre zuvor, im Jahr 1984 formulierte sie die folgende Ansage:
„Wenn wir Frauen auf dem Femininum bestehen, machen wir damit das Maskulinum geschlechtsspezifisch: In Ausdrücken wie Kolleginnen und Kollegen ist Kollege geschlechtsspezifisch, bezieht sich nur auf Männer. Wenn maskuline Bezeichnungen sich nur auf Männer beziehen können, sind sie, per definitionem, nur noch geschlechtsspezifisch und nicht mehr ‚auch geschlechtsneutral‘, wie bisher über sie behauptet wird.
Sie bekommen damit den gleichen Status wie die weiblichen Bezeichnungen, die auch nicht ‚neutral‘ für das andere, männliche Geschlecht stehen können.“Pusch, L.F.: Weibliche Personenbezeichnungen als Mittel weiblicher Realitätsdefinition. In: Kürschner, W./ Vogt, R., unter Mitwirkung von S. Siebert-Nemann [Hg.] Sprachtheorie, Pragmatik, Interdisziplinäres. Akten des 19. Linguistischen Kolloquiums Vechta 1984 (LA 157). Bd. 2. Tübingen: 257-273, hier S. 264
Frau Pusch benennt hier unmissverständlich ein Ziel und eine Strategie, um dorthin zu gelangen:
- Das Ziel: Das „Maskulinum2“ soll „geschlechtsspezifisch“ werden, also seine generische Funktion verlieren. Kurzbegriffe wie „Kollegen“ sollen also nicht mehr für alle Menschen gelten, sondern nur noch für Männer.
Das Ziel war also schon 1984 nichts weniger als die Eliminierung von ca. 15.000 Nomina Agentis, einer wirklich wichtigen Wörtergruppe.- Die Strategie: Erreicht werden sollte das Ganze, indem „wir Frauen“ stets auf dem Femininum bestehen und Doppelnennungen verwenden. Also statt „Meine Kollegen“ nur noch „Meine Kollegen und Kolleginnen“ sagen.
Die feministische Linguistik begann also spätestens 1984 mit der oben angesprochenen Eliminierung der Oberbegriffe, und zwar gezielt. Das belegt einen großen Anteil an der aktuellen Situation, belegt aber nicht, dass sie die einzigen waren.
Ungeklärt ist noch der Anteil der NS-Sprache. Ihre massenhafte Verbreitung der Doppelnennungen hatte auf jeden Fall die exakt gleiche Wirkung, die Frau Pusch 1984 beabsichtigte. Im Grunde war der Baum der Sprache an diesem Ast, den Nomina Agentis, schon durch die NS-Propaganda vorgeschädigt. Wie stark, muss noch erforscht werden.
Der gezielte Schlag der feministischen Linguistik traf auf eine Kerbe, die Hitler und Goebbels schon seit den 1920er Jahren gesetzt hatten; ihre Wirkungen addierten sich.
So ist es nicht verwunderlich, dass diese kleine Frauengruppe es innerhalb weniger Jahre schaffte, ihr Ziel in der bundesdeutschen Verwaltung festzuschreiben:
Den Anstoß gab 1990 die Saarländerin Marlies Krämer mit einer scheinbar banalen Situation. Sie weigerte sich, ihren neuen Reisepass abzuholen, da sie dort als „Inhaber“ hätte unterschreiben müssen. Sechs Jahre lang lebte sie ohne gültige Papiere, um gegen diese „maskuline Form“ zu protestieren.
Statt auf ein Gerichtsurteil zu warten, lenkte die Politik ein: Unter dem Druck des öffentlichen Protests ordnete der Bundesrat 1996 die Umschreibung aller deutschen Behördenformulare in die Doppelnennungs-Sprache an (z. B. „Inhaberin/Inhaber“).
Vom akademischen Vorschlag zur staatlich verordneten Sprache
In den Jahren zwischen 1984 und 1996 erhob die feministische Linguistik die asymmetrische, sexualisierende Sprache zur verordneten Verwaltungssprache – bemerkenswerterweise durch bloßen administrativen Beschluss, ohne dass Gerichte die Diskriminierung jemals formal bestätigt hätten.
Dabei hätten die Entscheidungsträger das Problem erahnen können, denn selbst die Frauen der frühen feministischen Linguistik waren sich über ihren damaligen Weg uneins. Zwei Vorschläge standen damals im Raum3:
- Nach der von Frau Pusch vertretenen Idee wäre es zu einer symmetrischen Sprache gekommen, die auf den kurzen, alle inkludierenden Oberbegriffen aufgebaut hätte. Sie hätte zu einer ähnlichen Gleichheit geführt, wie sie das Englische und die skandinavischen Geschwistersprachen schon hatten.
- Die anderen, linguistisch weniger bewanderten Frauen plädierten für die Beibehaltung der Asymmetrie, und statt dessen mit der „in“-Endung „endlich sichtbar“ zu werden. Also bei der Sprache zu bleiben, die ausgerechnet die furchtbaren Patriarchen milliardenfach verbreiteten, was aber offensichtlich nach 1945 effektiv „vergessen“ wurde.
Damals entschieden wenige, was sich 40 Jahre später in der ganzen Sprachgemeinschaft durchsetzen sollte.
Die Eintscheidung fiel gegen Luise Puschs Fachmeinung zugunsten derer, die mit ihrem Gefühl argumentierten:
Sie wollten nicht in „Dramaturg verschwinden“, sondern unbedingt „Dramaturgin“ sein.
Mit dieser Grundsatzentscheidung entschieden wenige Frauen, wie einmal die ganze Sprachgemeinschaft reden sollte.
Sie entschieden für das Gegenteil des Weges, für den sich die Geschwistersprachen per natürlichem Sprachwandel entschieden.
Auf den ersten Blickk sieht es also tatsächlich so aus, dass bei uns eine kleine Gruppe in den 1980er Jahren den eigenartigen Weg der deutschen Sprachgemeinschaft entschied, während in unseren Geschwistersprachen in einem einer Schwarmintelligenz gleichenden Prozess der gegenteilige Weg eingeschlagen wurde.
Was damals offensichtlich nicht in die Entscheidung der Frauen einfloss:
- Ist es wirklich für Frauen besser, mit einer eigenen Endung markiert zu werden, die Männer aber nicht?
- Der Fakt, dass die Nationalsozialisten keine 40 Jahre zuvor so redeten, wie sie für sinnvoll erachteten.
So kam es zu der völlig paradoxen Situation, dass sich die Frauen im Kampf gegen das Patriarchat ausgerechnet für die Sprache der schlimmsten Patriarchen entschieden; damit sogar erfolgreich vor Gericht zogen. Für eine Sprache, die Frauen auf immer zu Anhängseln von Männern zu machen droht.
Der Faschismus von damals basiert genauso wie der von heute auf dem Trennen und Aussortieren von Menschen: Arier und Nicht-Arier, Volksgemeinschaft und ihre Feinde, Juden und Nicht-Juden, Menschen mit gesundem und mit falschem Erbgut, lebenswertes und nicht lebenswertes Leben. Diese Trennung ist der Ausgangspunkt für Vernichtung und Krieg.
Die Gegner des Faschismus versuchen statt dessen zusammen zu führen. Sie akzeptieren die Unterschiede und tolerieren statt auszugrenzen.
Wie die verlinkten Aussagen von Frau Pusch belegen, stritten sich die Frauen Anfang der 1980er um zwei Wege.
Entweder die gemeinsamen Oberbegriffe behalten, oder sie zu eliminieren und den Weg der Trennung in Männer und Frauen zu gehen.
In dieser kleinen Gruppe fiel die Entscheidung für den Weg der Trennung; gegen den Rat der Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch.
War diese Gruppe aufgrund ihres Wissensstandes überhaupt dazu in der Lage, die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu überblicken? Wie es aussieht, wusste sie noch nicht einmal von der NS-Vergangenheit der Doppelnennungen. Konnten sie überhaupt die problematischen Hintergründe des Einteilens und der damit verbundenen Folgen überblicken?
Faktisch gibt es keine Einteilung in „die einen“ und „die anderen“ ohne Probleme im Grenzbereich. Das gilt bei allen oben genannten Einteilungen, aber auch bei der Einteilung in Männer und Frauen. Es gibt Kinder, die nach ihrer Geburt nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Das BVG hat 2017 dieser Gruppe der Intersexuellen den Rücken gestärkt, indem es deren Diskriminierung untersagt hat.
Wussten die Frauen, die sich Anfang der ’80er für den Weg des Einteilens nach Geschlechtern entschieden, überhaupt etwas von dieser grundsätzlichen Problematik? Als sie sich dafür entschieden, „Dramaturgin“ genannt zu werden, und nicht, wie in den anderen Geschwistersprachen, zusammen mit allen anderen „Dramaturg„?
Intersexualität gibt es schon immer. Hätten damals Wissenschaftler statt Aktivisten über „Getrennt“ oder „Zusammen““ geredet, wäre dieses Problem wahrscheinlich zur Sprache gekommen und der gemeinsame Weg gewählt worden..
Um aus der aktuell so verfahrenen Situation heraus zu finden, müssen all diese Dinge wissenschaftlich aufgearbeitet werden.
Das sollte völlig unabhängig von persönlichen Sprachvorlieben passieren. Das genau ist der Unterschied zwischen einer seriösen, rein beobachtenden Wissenschaft und einer „interagierenden Wissenschaft“.
Die Feministische Linguistik hatte sich aber von Beginn an als „interagierende Wissenschaft“ verstanden. Sie beobachtete nicht nur, sondern griff ein. Die Genderlinguistik hat sich nie aus dieser Tradition gelöst.
Eine feministische Linguistik bzw. die aus ihr hervorgegangenen Genderlinguistik mit solchen großen Fördersummen auszustatten heißt die zu fördern, die mit ihren Forschungen nicht die Wahrheit herausfinden wollen, sondern versuchen, das als wahr zu finden, was sie für richtig halben.
Dass die Genderlinguistik heute weiter das „generische Maskulinum“ am Pranger stehen lässt, statt die neuen Forschungsergebnisse mit in ihr Agieren einzubeziehen zeigt, dass hier auch in Zukunft keine Wissenschaftlichkeit zu erwarten ist.
Ein guter Anfang sind immerhin solche Eingeständnisse wie dieses hier von Luise Pusch4 , wo sie anerkennt, dass die lange am Pranger beschimpften Nomina Agentis zu ihrer Entstehungszeit für Männer und Frauen gleichermaßen galten. In diese Richtung sollte es weiter gehen. Andere Wege sind tatsächlich nicht in Sicht.
Fazit: Die um sich greifenden Doppelnennungen werden zwar geschlechtergerecht oder gendersensibel genannt, sind aber das Gegenteil. Sie trennen, grenzen aus, sexualisieren und machen gleichzeitig die Sprache unötig kompliziert.
Statt dessen sollten wir bei den verbindenden, alle benennenden Nomina Agentis bleiben, und dabei anerkennen, dass sie in Wirklichkeit überhaupt nichts mit Männern zu tun haben. Außer dieser fatalen Fehlbenennung „Maskulinum“ durch altgriechische Männer 450 vor Christus.
Fußnoten:
- Siehe https://vergendert.de/unser-eigenartiger-weg ↩︎
- Heute wissen wir, dass die Kritik am „generischen Makulinum“ auf zwei falschen Fakten“ beruht:
1. Als die Nomina Agentis entstanden, gab es nur ein Genus, welches für alle und alles galt, natürlich auch für Frauen. Erst danach fanden zwei weitere Genera in das Protoindogermanischet: erst das „Neutrum“ (!), später das „Femininum“
2. Eine Fehlbenennung der Genera um 450 vor Chr. in „Maskulin, Feminin und Neutrum“. Faktisch hatten die Genera nie etwas mit Geschlechtern zu tun; wahrscheinlich hätten wir ohne diesen ersten großen Fehler der Sprachwissenschaften heute keinen Gendersprachenstreit, da der größte Teil der Argumentation des Feminismus auf diesem Fehler aufbaut. Details siehe Begriffsklärungen ↩︎ - Luise F. Pusch im Indubio-Podcast von Gerd Buurmann am 23. 7. 2023: Wir hatten vorgeschlagen, wir wollen das “-in” abschafffen. Es ist eine Beleidigung. Dadurch wird also gesagt, die Frau ist sozusagen eine Ableitung, oder eine Abart des Mannes. Und deswegen: alle Movierungen werden abgeschafft, und wir verlassen uns nur noch auf die Artikel. Wir sagen das Lehrer, die Lehrer und der Lehrer.
Da es aber so war, dass, die Frauen haben gesagt, also ich bin jetzt endlich Dramaturgin hier an meinem Theater, ich möchte jetzt nicht in das Dramaturg verschwinden, oder wieder sagen, ich bin ein Dramaturg, ich möchte jetzt mal dass in meiner Sprache ein paar Feminina vorkommen. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann werden wir erst mal die Feminisierung betreiben, dass die Sprache überhaupt mehr Feminina zeigt… ↩︎ - Immerhin gestand Frau Pusch einen großen Teil des damaligen Fehlers in der Bosetti-late-Night im Gespräch mit Alicia Joe am 22. 4. 2024 ein: „Also es ist richtig, was Sie gesagt haben, dass früher diese Personenbezeichnungen für beide Geschlechter galten. Also das hat gerade Herr Meineke für das Hethitische wieder herausgedröselt. Aber, andererseits interessiert mich das eigentlich nicht, was die Hethiter damals gemacht haben, sondern mich interessiert das, was wir heute unter dieser Männersprache zu leiden haben.“ ↩︎